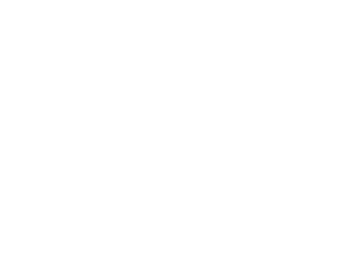Breadcrumb
„Wir schlafen nicht mehr in unseren Häusern“
Themengebiet:

Seit langem kämpft die Bevölkerung der Kivu-Provinzen im Osten der Demokratischen Republik Kongo um ihr Überleben: Wegen der anhaltenden und gerade wieder zunehmenden Gewalt in der Region, aber auch wegen fehlender Infrastruktur und fehlender Gesundheitsversorgung. Die Menschen leben in Angst und Unsicherheit, inmitten von Kriegswirren.
In den vergangenen Monaten sind viele Menschen in Vertriebenencamps und Transitlager geflohen, aus Angst nachts zuhause angegriffen zu werden. In den Straßen sind Kolonnen von Menschen zu sehen, die Matratzen mit sich tragen. Die Dörfer, normalerweise voller Leben, sind jetzt vollkommen still.
Alltägliche Gewalt
„Im vergangenen Monat wurde das Dorf meiner Eltern angegriffen. Sie versuchten, wegzulaufen, aber meine Mutter schaffte es nicht. Sie töteten sie mit einer Machete. Mein Vater rannte, aber er wurde erschossen. In dem Dorf zählten sie elf Menschen, die mit einer Machete getötet wurden - viele andere wurden in ihren Häusern verbrannt, und sie konnten die Toten nicht mehr zählen“, erzählt eine 30-jährige Mutter von fünf Kindern. Sie selbst entkam dem Angriff auf ihr Dorf in Nord-Kivu im Mai, ihr Mann und eines ihrer Kinder werden vermisst.
Tausende Menschen leben heute bei Gastfamilien - bei Fremden, die ihre Hütten und Lebensmittel mit denjenigen teilen, die auf der Flucht sind. Viele verstecken sich in den Wäldern, unter dem Schutz von Plastikfolien, die sie mit Blättern bedecken, damit sie aus der Ferne nicht gesehen werden.
Aus Angst zu spät in die Klinik
In den Einrichtungen von Ärzte ohne Grenzen steigt die Zahl der Patienten, die erst in einem lebensbedrohlichen Zustand eintreffen. Sie oder ihre Familien entscheiden zunächst, keine medizinische Versorgung aufzusuchen, weil sie fürchten, unterwegs verletzt oder erpresst zu werden.
„Eine Frau begann spät nachts eine Fehlgeburt zu haben, sie blutete stark. Aber mit all dem Militär und den bewaffneten Gruppen auf der Straße hatte ihre Familie zu viel Angst, sich nachts auf den Weg zu machen. Sie warteten daher bis zum Morgen, bevor sie sich zu Fuß zum einige Stunden entfernten Krankenhaus aufmachten. Sie kamen mittags an. Da hatte die Frau bereits zu viel Blut verloren, und wir konnten nicht mehr viel tun. Sie starb Minuten nach ihrer Ankunft“, berichtet eine Krankenschwester von Ärzte ohne Grenzen im Krankenhaus Mweso in Nord-Kivu.
Gefahr der Mangelernährung
An manchen Orten sehen die Teams von Ärzte ohne Grenzen steigende Patientenzahlen - mehr als 40 Prozent in einem der Gesundheitszentren - weil die Kämpfe mehr Menschen in die Gegend treiben. An anderen Orten nehmen die Patientenzahlen ab, weil die Bewohner geflohen sind oder sich verstecken.
Auch wenn die Region grün und fruchtbar ist, besteht für die Schwächsten und Anfälligsten die Gefahr der Mangelernährung, denn die Menschen haben Angst, die Ernte einzubringen oder zum Markt zu gehen.
„Ich traf heute Morgen mit meiner schwer mangelernährten Tochter im Krankenhaus ein. Wir leben in einem Dorf drei Stunden Fußmarsch von hier entfernt. Wegen der Unsicherheit in den letzten Wochen schlafen wir nicht mehr im Haus, sondern auf den Feldern oder im Busch. Nachts greifen Banditen das Dorf an, tagsüber gibt es kriegerische Auseinandersetzungen. Es ist schwierig, Nahrung zu finden, wenn geschossen wird, und wir nicht auf die Felder gehen können“, sagt die Mutter einer vierjährigen Patientin in einem Ernährungszentrum von Ärzte ohne Grenzen in Nord-Kivu.
Vermeintliche Kämpfer werden angegriffen
Seit April 2012 hat Ärzte ohne Grenzen mehr als 200 Menschen behandelt, die bei Zusammenstößen zwischen bewaffneten Gruppen verwundet wurden. Die Teams behandeln Verletzte, die als vermeintliche Kämpfer mit Macheten angegriffen oder beschossen wurden. Patienten und Personal berichten von Verwandten, die entführt und von bewaffneten Gruppen gezwungen wurden, Nachschub und Beute aus Plünderungen zu transportieren.
„Ich verließ mein Dorf mit meiner Familie als die Kämpfe begannen. Am Mittwoch kehrte ich mit einigen Freunden auf mein Feld zurück, um Gemüse zu ernten. Wir hatten nichts zu essen. Wir hörten Schüsse, und eine Kugel traf meinen linken Arm und blieb stecken. Ich kehrte mit meinen Freunden, die nicht verwundet wurden, ins Dorf zurück. Dort bauten sie eine Trage aus Zweigen, um mich zur Hauptstraße zu tragen, wo wir ein Motorrad zur nächsten Stadt fanden. Wir warteten bis zum nächsten Tag bevor wir ins Krankenhaus gingen, weil wir nachts nicht unterwegs sein wollten“, berichtet ein 28-Jähriger aus Nord-Kivu.
Ärzte ohne Grenzen leistet in Nord- und Süd-Kivu medizinische Hilfe in 10 Referenzkrankenhäusern, 31 Gesundheitszentren und 9 Gesundheitsposten, sowie wöchentlichen mobilen Kliniken und Cholerabehandlungszentren. Außerdem reagieren die Teams auf akute Krisen.