Breadcrumb
Wie startet ein Hilfseinsatz? — Ein Arzt berichtet
Themengebiete:
„Ich war bei der Eröffnung von Projekten in Libyen, im Südsudan und in Syrien dabei“, sagt Dr. Tankred Stöbe. Vieles muss dabei bedacht werden: Wie groß ist die Not und wie schwierig die Sicherheitslage? Anhand seiner Einsatzerfahrung gibt der Arzt tiefere Einblicke in die Frage: Wie startet ein Hilfseinsatz bei Ärzte ohne Grenzen?

Und immer wieder denke ich an das, was mir Flüchtende, die ich in einem früheren Einsatz getroffen habe, über ihre Zeit in Libyen erzählt haben. Ich sprach zum Beispiel mit Somaliern, in deren Heimat ein Bürgerkrieg herrscht, und doch sagten viele: „In meiner Heimat konnte ich nicht bleiben, aber Libyen ist noch schlimmer.“ Immer wieder hören wir von Folter in Libyen, davon dass Mitinhaftierte in den Internierungslagern verhungerten. Von Vergewaltigungen und Sklaverei.
Wie startet ein Hilfseinsatz bei Ärzte ohne Grenzen?
Nun bin ich auf dem Weg dorthin. Ich schaue aus dem Flugzeugfenster und bereite mich innerlich auf meine Rolle vor: Als Arzt und Projektkoordinator bin ich Teil eines sogenannten Explo-Teams – einer Gruppe aus vier Experten. Diese verschafft sich einen Überblick über die Not der Menschen und überlegt, wie Ärzte ohne Grenzen helfen kann – wie und wo wir Projekte eröffnen sollten.
Aber wie startet eigentlich ein Hilfseinsatz? Gerne gebe ich Ihnen Antworten und nehme Sie dazu mit in drei Länder, in denen ich bei der Eröffnung von Projekten dabei war – in Libyen, im Südsudan und in Syrien.
In Libyen treffe ich mein Team: Ein Kollege kommt aus Frankreich, zwei stammen aus Libyen selbst. Sie sind eine unabdingbare Hilfe, wenn es darum geht, zu übersetzen, Kontakte herzustellen oder einen sicheren Weg von A nach B zu finden. Eine der ersten Stationen, die wir uns anschauen, ist ein Internierungslager für Geflüchtete. Dort werden Menschen festgehalten, die auf dem Weg nach Europa waren, aber auch solche, die in Libyen arbeiteten und wahllos aufgegriffen wurden.
Hingehen, Sehen, Handeln
Die furchtbaren Beschreibungen der aus Libyen Flüchtenden, die wir an Bord unserer Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer behandelten, bestätigen sich für mich in dem Internierungslager auf grausame Weise.
Kaum, dass wir die Tür öffnen, schlägt mir ein beißender Geruch entgegen. Ich schaue in verängstigte Gesichter einer Frauengruppe: 39 Menschen, 39 individuelle Schicksale. Sie hofften Schutz zu finden in Europa, Arbeit, ein erträgliches Leben. Doch das Schlauchboot, auf das sie von Schleppern bei Nacht gezwungen wurden, erreichte nicht die internationalen Gewässer. Die libysche Küstenwache fing sie ab und brachte sie hierher. Sie kommen aus Nigeria, wo im Norden des Landes Kämpfe zwischen der bewaffneten Gruppe Boko Haram und Regierungstruppen Hunderttausende vertrieben haben. Seit einem Monat werden diese Frauen nun hier gefangen gehalten, vollkommen ohne Kontakt zur Außenwelt. Nicht einmal ihre Familien wissen, wo sie sind. Was für eine schreckliche Situation.
Ich frage die Frauen, woher der Geruch kommt. Sie wollen zunächst nicht antworten, doch dann zeigen sie mir ihre sanitären Räume. Der Boden ist knöcheltief mit Urin und Kot bedeckt. Toiletten, Waschbecken, Wasserhähne oder Duschen, das alles gibt es hier nicht mehr. Auf meine Frage, ob sie medizinische Probleme haben, reihen sie sich für meine Sprechstunde ein. Nahezu alle Frauen leiden an Hautinfektionen – Resultat der katastrophalen hygienischen Bedingungen. Die entsprechenden Medikamente habe ich zum Glück dabei. Viele Frauen berichten von generalisierten Schmerzen, wohl als Ausdruck von erlittenen seelischen Traumata.
Ich habe in meinen Einsätzen viel erlebt, aber das Schicksal dieser Frauen schockiert und berührt mich. Später besuchen wir noch weitere Orte in Libyen, um festzustellen, wie und wo wir die Not der Menschen lindern können. Die Bilder in den Lagern gleichen sich und eines ist für mich klar: Niemand sieht sich für die schreckliche Not der Menschen verantwortlich. Wir werden uns um die hygienischen Bedingungen in Internierungslagern kümmern, und wir müssen dort medizinische Sprechstunden starten, um die nötigste Versorgung sicherzustellen.
Wie stellen wir eine Ernährungskrise fest?
Das Nötigste sicherstellen, damit Menschen gesund werden oder schlicht überleben – darum geht es immer, wenn wir Projekte eröffnen. Sei es nach Naturkatastrophen, in Kriegsgebieten oder bei Epidemien. Bei meinem „Explo-Einsatz“ im Jahr 2014 im Südsudan ging es um eine Ernährungskrise in Folge eines anhaltenden Konfliktes. Hunderttausende waren vertrieben, Felder lagen brach oder waren jetzt in Folge der Regenzeit überschwemmt.

Wir fuhren in entlegene Gebiete, um zu sehen, ob die Menschen dort Nahrungsmittelhilfe und medizinische Versorgung brauchen. Wenn wir in einem Dorf ankamen, riefen wir die Menschen zusammen. Wir untersuchten alle Kinder bis zum fünften Lebensjahr, weil sie am gefährdetsten sind, an Mangelernährung zu sterben. Dazu hatten wir ein Holzgestell – ähnlich einem Tor – errichtet. Die Kinder, die unter der 1,10 Meter hohen Querlatte durchlaufen konnten, untersuchten wir weiter. Mit einem Maßband, das man um den Oberarm legt, können wir rasch sehen, ob die Buben und Mädchen mangelernährt sind.
Statistik und Einzelschicksale
Ich erinnere mich noch an den vierjährigen Koang Ruod, den wir damals untersuchten. Schüchtern und schwach versteckte er sich auf dem Schoß seiner Mutter. Behutsam legte ich das Maßband um seinen dünnen Arm: Es zeigte den orangen Bereich an – Koang war also mangelernährt. Wir gaben ihm hochkalorische Fertignahrung, denn sonst hätte sein Gesundheitszustand schnell lebensbedrohlich werden können. Seiner Mutter gaben wir noch weitere Rationen für ihn mit nach Hause.
Es gibt statistische Werte für die Anzahl mangelernährter Kinder, an denen wir uns in solchen Situationen orientieren und die uns erkennen lassen, ob eine Ernährungskrise vorliegt. Auch heute noch ist die Lage im Südsudan vielerorts leider nicht besser.
Ernährungskrisen haben viele Ursachen und sind immer das Resultat mehrerer Faktoren, oft spielen Konflikte eine große Rolle. Aktuell ist die Mangelernährungsrate zum Beispiel in einigen Regionen Äthiopiens, Somalias, Nigerias und dem Jemen besonders hoch. In drei dieser Länder haben wir seit Jahren zahlreiche Projekte, in Somalia sind unsere Teams gerade dabei, unsere Hilfe wieder aufzubauen, nachdem wir das Land 2013 aus Sicherheitsgründen verlassen mussten.
Hilfe in unsicheren Gegenden
Es schmerzt mich besonders, wenn wir helfen wollen, aber Kämpfe und Gewalt dies unmöglich machen. In Syrien ist die Lage seit Jahren unerträglich. Unsere Hilfe müsste viel umfassender sein, aber die Sicherheitslage lässt dies vielerorts nicht zu – dann können wir kein Projekt eröffnen. 2012 hatte ich selbst ein Krankenhaus im Norden Syriens mit aufgebaut. In einer Höhle installierten wir eine Erste-Hilfe-Station und einen Operationssaal, den wir in einem aufblasbaren Zelt eingerichtet hatten. Die Höhle war nahe der Front, doch sie bot einen natürlichen Schutz. Dort versorgten wir damals viele Patienten. Diese Menschen waren oft schwer verletzt, und es gab sonst keine andere medizinische Hilfe.

Wir bleiben weltweit an der Seite von Menschen in Not. Dabei ist es besonders wichtig, dass wir unsere Hilfe unabhängig und unparteilich anbieten. Das heißt, wir verfolgen keine politischen oder wirtschaftlichen Interessen. Allein die Bedürfnisse der Menschen sind für uns ausschlaggebend. Für die Konfliktparteien können wir dies glaubhaft versichern, weil wir uns durch Spenden von vielen Privatpersonen wie Ihnen finanzieren.
Durch Ihre Spenden ermöglichen Sie es uns, eigenständig zu entscheiden, wo wir Projekte eröffnen – dass wir Explo-Teams losschicken, die sich an der Not der Menschen orientieren. So können wir an Orten helfen, wo sonst keiner hilft.
Das ist mein Anspruch als Arzt: Ob in Libyen, in entlegenen Dörfern des Bürgerkriegslandes Südsudan oder in anderen Krisenländern – jeder Mensch in gesundheitlicher Not soll die Chance auf eine schnelle Versorgung, auf ein Überleben haben.
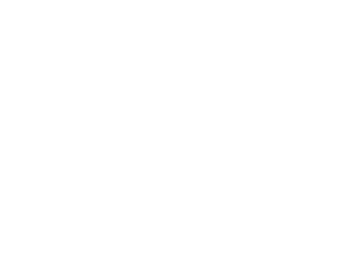


Neuen Kommentar schreiben