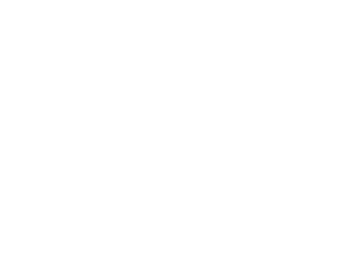Breadcrumb
Ukraine: “Wenn das Bombardement beginnt, rennst du in den nächsten Keller“
Themengebiet:
Alyona F.*, 24, ist aus Debalzewe, einer stark umkämpften Stadt an der Frontlinie des Ukraine-Konflikts. Als sich die Kämpfe im Januar verschärften, blieb Alyona F. mit ihrem Mann und dem zwei Jahre alten Sohn Gleb im Keller. Schließlich wurde die Situation so unerträglich, dass sie am 29. Januar aus der Stadt flohen. Derzeit halten sie sich im Wald von Svyatogorsk, einem Kurort rund 115 Kilometer von Debalzewe auf. Dort suchen mehr als 350 weitere Vertriebene Zuflucht. Alyona F. bekommt Unterstützung von einem Psychologen von Ärzte ohne Grenzen, weil sie sich große Sorgen um die Auswirkungen macht, die der Konflikt und die Fluchterfahrung auf ihren Sohn haben. Vor kurzem hat Ärzte ohne Grenzen begonnen, medizinische Basisversorgung für die Menschen in dem dortigen Sanatorium bereitzustellen.
"Mein Mann, mein Sohn und ich verließen Debalzewe zum ersten Mal im Juli, zwei Wochen vor einer militärischen Offensive. Wir flohen nach Konstantinovka. Im Oktober gingen wir jedoch zurück nach Debalzewe, weil meinem Mann aufgrund seiner Abwesenheit die Kündigung drohte.
Mittlerweile ist uns klar, dass die Ereignisse im Sommer nichts im Vergleich zu dem waren, was derzeit in Debalzewe passiert. Schon bevor die Kämpfe am 19. Januar zunahmen, hielten wir uns nur noch selten in der Wohnung auf. Wir verbrachten den Großteil der Zeit in dem Keller, den wir zuvor monatelang eingerichtet hatten. Wir hatten geputzt und Matratzen nach unten gebracht – wir taten alles, was wir uns leisten konnten, damit wir einen besseren Ort hatten, an dem wir Schutz suchen konnten. Letztendlich ist es aber so, dass du einfach in den nächstgelegen Keller rennst, wenn die Bombardierungen beginnen.
Es gab Zeiten, in denen wir den Keller nicht verlassen konnten
An einigen Tagen gab es keine Angriffe. Dann wiederum gab es Zeiten, in denen wir den Keller gar nicht verlassen konnten. Irgendwann hörten die Menschen auf, auf dem regelmäßigen Beschuss große Aufmerksamkeit zu schenken. Sie konnten einordnen, wann aus Debaltseve hinaus abgefeuert wurde oder in die Stadt hinein. Einmal war ich gezwungen, mich mit meinem kleinen Sohn im Badezimmer zu verstecken. Als er nach draußen sah, fragte er mich: "Kommt es zu uns oder geht es von uns aus, Mama?"
In den zehn Tagen, bevor wir hier hergekommen sind, hielten wir uns ohne Strom und ohne Heizung im Keller auf. Die Schutzräume sind Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind entsprechend vernachlässigt und feucht. Es war sehr kalt, etwa acht Grad, und wir waren etwa 20 bis 25 Personen in dem Keller. Menschen brachten uns etwas zu essen. Aber da es keinen Strom gab, mussten wir Mini-Ofen mit einer Gasflaschen verbinden, um zu kochen.
Hauptproblem: Die Menschen hatten kein Geld mehr
Alle Keller der Stadt waren überfüllt. Ältere Menschen, Kinder, alle suchten hier Schutz. Und viele wurden krank. Vor dem 19. Januar war es noch möglich, Medikamente in den Apotheken der Innenstadt zu bekommen. Spezielle medizinische Behandlungen gab es nicht mehr. Auch das Essen war sehr teuer, da die Versorgung immer komplizierter wurde. Zudem gab es kein Geld, weil es nur noch eine Bank in der Stadt gab. Das Hauptproblem war jedoch, dass die Menschen kein Geld mehr hatten, das sie hätten abheben können. Unternehmen befanden sich praktisch in einem Standby-Modus, was dazu führte, dass die Leute nicht bezahlt wurden.
Wir wurden von Freiwilligen evakuiert. Ein Bus sollte uns um 8 Uhr morgens abholen, aber wir mussten bis 15 Uhr warten, weil das Fahrzeug aufgrund von Bombardements nicht weiterfahren konnte. Es war beängstigend, draußen zu warten, in der Nähe eines Gebäudes, das früher bereits mehrfach beschossen worden war. Während wir dort alle zusammen warteten, musste ich daran denken, dass dies ein Massengrab werden könnte. Erst um 7 Uhr morgens hatte eine Frau durch einen Granateneinschlag ein Bein verloren. Als der Krankenwagen fünf Stunden später eintraf, war sie bereits verblutet.
Es ist schrecklich zu warten, bis sie anrufen
Der Großteil meiner Familie wurde aus Debalzewe evakuiert, doch einige Familienmitglieder entschieden sich zu bleiben. Nun haben sie keine Möglichkeit mehr, zu gehen. Nur selten können sie ihre Mobiltelefone laden, und so ist es immer schrecklich, zu warten, bis sie anrufen und sagen, dass es ihnen gut geht. Wir sind dieser Situation alle müde, dass wir uns jeden Tag erinnern und uns all diese Gedanken machen müssen.
Der Psychologe von Ärzte ohne Grenzen sprach mit meinem Jungen und sagte, dass es ihm gut gehe. Es gibt eine Frau, die hier lebt und ziemlich oft vorbeikommt, um mit den Kindern zu spielen. Sie versucht, sie zu unterhalten. Die Freiwilligen bringen eine Menge Spielzeug für unsere Kinder, aber Sie können sehen, welche Spiele bei den Kindern gerade am beliebtesten sind. [Alyona blickt auf ihren Sohn, der mit Spielzeugpistolen spielt, Anm.] Ich bemerkte, dass er nicht von mir entfernt sein will. Er hat immer noch Angst. Ich hoffe nur, dass mein Kind aus dieser Zeit keine Narben davontragen wird. Zeigen wird das erst die Zeit.
Von Organisationen und Freiwillige bekommen wir hier Essen, und wir hoffen, dies auch in den kommenden Tagen zu bekommen. Wir leben von dem Geld, das wir mit uns nahmen, als wir die Stadt verließen.
Wir haben keine Pläne für die Zukunft. Es ist schwierig, Hoffnung zu haben. Jeder ist betroffen, geistig oder körperlich. Die Menschen hatten alles, doch jetzt ist mein Kind obdachlos. Es ist unmöglich, die Uhr zurückzudrehen."
* Name geändert