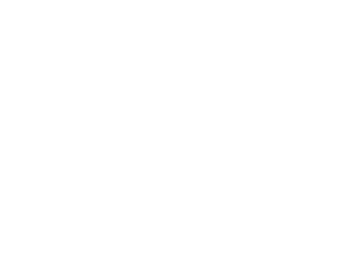Breadcrumb
HIV/AIDS: Kampf gegen Diskriminierung
Themengebiete:

„Kurz nachdem ich geheiratet habe wurde ich krank. Das war im Jahr 2006, damals arbeitete ich in Saudi-Arabien. Ich ging ins Krankenhaus, wo ich herausfand, dass ich HIV-positiv war. Zuerst war ich geschockt, ich wusste nichts über die Krankheit und dachte, dass mir jeder aus dem Weg gehen würde. Ich dachte, ich würde innerhalb einer Woche sterben und machte mir Sorgen um meine Mutter und meine Frau, die im fünften Monat schwanger war. Meine Frau hat die Nachricht gut aufgenommen. Sie wurde getestet um herauszufinden ob sie auch infiziert war. Ich wollte ihr die Wahl lassen bei mir zu bleiben oder zu gehen falls sie negativ war, aber sie sagte, dass wir zusammen leben und sterben würden."
Abo-Mohaned ist 35 Jahre alt und lebt in Jemens Hauptstadt Sana’a. Die HIV Epidemie hat im Jemen ein vergleichsweise geringes Ausmaß; etwa 0,2 Prozent der Bevölkerung sind betroffen. Jedoch sind HIV-infizierte Menschen so gut wie überall Diskriminierung ausgesetzt, auch in manchen Gesundheitseinrichtungen. Abo-Mohaned hat das am eigenen Leib erlebt: „Als die Zeit der Geburt gekommen war, sind wir in zwei Krankenhäuser gegangen, doch beide haben es abgelehnt meiner Frau zu helfen. Die einzige Lösung war, sie in ein drittes Spital zu bringen und ihren HIV Status zu verschweigen.“
Dr. Abdul Fattah arbeitet in der HIV/AIDS Klinik im Al-Gumhuri-Krankenhaus, der einzigen Einrichtung in Sana’a in der eine antiretrovirale Behandlung angeboten wird. Derzeit werden hier rund 445 Menschen betreut. Als er Medizin studierte, starb einer seiner Freunde, allein und ohne jegliche medizinische Versorgung. Er beschloss, sich dem Kampf gegen die Krankheit zu widmen. „Dieses Ereignis war für mich der Grund, mich über HIV zu informieren. Als ich dann mein Medizinstudium abgeschlossen hatte, hörte ich von diesem Krankenhaus, also fing ich an hier zu arbeiten.“
„Gegen Diskriminierung anzukämpfen ist eine große Herausforderung,” sagt Dr. Abdul Fattah. „Anfangs wurden Patienten mit HIV vom Krankenhaus abgelehnt. Unter Druck und nach Schulungen des medizinischen Personals hat sich die Situation ein wenig verbessert. Dennoch gibt es viele respektierte Ärzte die bei der Erwähnung von HIV in Panik geraten.“
Mehr unterstützung notwendig
Neben dem Krankenhaus gibt es fünf Zentren in Sana’a, in denen Menschen, die ihren HIV-Status wissen wollen, sich testen lassen können und auch die Möglichkeit einer Beratung vor- und nach dem Test haben. Allerdings sind die Tests um HIV zu diagnostizieren in den vergangenen Monaten ausgelaufen. Der Globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria wird die Tätigkeiten im Jemen bis 2014 unterstützen, allerdings nur um lebensrettende HIV-Medikamente für Menschen sicherzustellen, die bereits mit der Behandlung begonnen haben. „Wir haben ausreichend finanzielle Unterstützung für die Versorgung und Behandlung, aber für andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Bewusstseinsbildung, brauchen wir mehr. Es mangelt an Mitteln für Beratung und Diagnose, besonders für die Vorbeugung einer HIV-Übertragung von Müttern auf Kinder. Genau das sind aber die Angebote, die wir verstärken müssen,“ erklärt Dr. Adbulhameed, der Direktor des nationalen AIDS-Programms im Jemen.
Erstes HIV/AIDS-Programm in einem arabischen Land
Seit Beginn des Jahres arbeitet Ärzte ohne Grenzen in Sana’a und versucht dem Stigma, mit dem HIV infizierte Menschen behaftet sind, entgegenzuwirken, sowie deren Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. „Die starke Diskriminierung von Personen, die mit HIV leben, führt dazu, dass ihnen der Zugang zu Gesundheitseinrichtungen erschwert wird – die Betroffenen haben Angst davor, wie sie behandelt werden, und manchmal ist diese Angst auch berechtigt,“ sagt Sue Petrie, Koordinatorin des HIV-Programms von Ärzte ohne Grenzen in Sana’a. „Unser Ziel ist es, Hand in Hand mit dem nationalen HIV/AIDS-Programm zu arbeiten, deren Aktivitäten zu unterstützen und die Situation für Menschen, die mit HIV leben, zu verbessern.“
Der Diskriminierung ausgesetzt
„Ich fand heraus, dass ich HIV positiv bin, nachdem mein Ehemann gestorben war,“ sagt die 35-jährige Um Abdul Rahman. „Ich wurde von einer mir sehr nahe stehenden Person diskriminiert: Von meinem eigenen Vater. Er hat mich sehr enttäuscht. Er sagte mir, ich müsste dorthin zurückgehen, wo ich mir das Virus eingefangen hatte. Er hat mich aufgegeben.“
Um Abdul Rahman musste erfahren, dass die Situation als Frau noch schwieriger ist : „Es ist wirklich schwer, weil ich eine Frau bin. Als ich herausfand, dass ich HIV-positiv bin, hatte ich keine Mittel meine Töchter zu unterstützen. Wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte ich einen Job finden können, jeden Job.“
Offiziellen Daten Zufolge gibt es mehr HIV-infizierte Männer als Frauen. Jedoch warnt Dr. Abdulhameed, dass diese Daten möglicherweise nicht die tatsächliche Anzahl der betroffenen Frauen reflektiert: „Frauen haben möglicherweise aus verschiedenen Gründen, im Zusammenhang mit Diskriminierung oder mit Gewalt gegen Frauen, keinen Zugang zur Versorgung. Wir müssen unsere Aktivitäten ausbauen um HIV- Patientinnen ausfindig zu machen.“
Glücklicherweise fand Um Abdul Rahman Hilfe bei einer der lokalen Hilfsorganisationen im Jemen, die HIV-positive Menschen unterstützen: „Ich habe noch einmal geheiratet. Jetzt bin ich verheiratet und habe vier Töchter und einen Sohn.“
Unterstützung durch andere Hilfsorganisationen
Organisationen wie AID Association oder No Stigma Foundation kämpfen darum, Menschen, die mit HIV leben zu unterstützen sowie ihre Rechte zu vertreten. „Unser Verein wurde 2007 von einer Gruppe junger Freiwilliger, die vom Thema AIDS betroffen waren, gegründet,“ sagt Abdulhafed Al-Ward, Generalsekretär der AID Association . „Wir waren der Meinung, dass betroffene Personen stigmatisiert und vieler Dinge im täglichen Leben beraubt wurden: medizinisch, sozial und rechtlich.“ Die AID Association fördert das Bewusstsein der Krankheit innerhalb der Bevölkerung und hilft HIV-positiven Menschen ihren Lebensunterhalt zu verdienen, indem sie Kleinkredite vergibt und Trainingskurse organisiert.
„Solche Initiativen helfen die Situation der am meisten von HIV/AIDS Betroffenen zu verbessern,“ sagt Petrie. „Ärzte ohne Grenzen möchte mit diesen Hilfsorganisationen arbeiten, da es sich um eine engagierte Gruppe von Personen handelt, die bemüht sind, Fragen und Themen der mit HIV lebenden Bevölkerung anzusprechen und Diskriminierung zu reduzieren. Das ist eines der Hauptziele unserer Arbeit hier: Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen, Diskriminierung zu minimieren und Zugang sowie Akzeptanz zu verbessern. Letztlich wollen wir die Aktivitäten für diese Betroffenengruppe ausbauen.“
*Die Namen der Patienten und Patientinnen wurden aus Gründen des Datenschutzes gerändert.