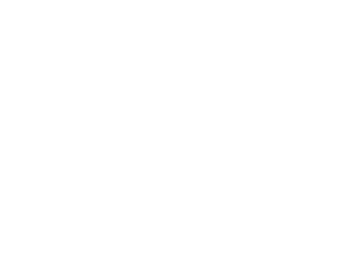Breadcrumb
Syrien: „Ich gehe lieber auf eines der Todesschiffe, als hier zu bleiben.“ – ein Arzt berichtet
Themengebiet:

Der syrische Kinderarzt Dr. Marwan versorgte Kriegsverletzte in seiner Heimstadt Raqqa und arbeitete mit Ärzte ohne Grenzen im Norden des Landes. Nachdem er jedoch ein Jobangebot des Islamischen Staats (ISIS) ablehnte, wusste er, dass er in Lebensgefahr schwebte. Also traf er den schwierigen Entschluss, sich mit seiner Familie auf den Weg nach Europa zu machen.
„Ich war Kinderarzt in Syrien, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Wir lebten in Raqqa, der Stadt, die nun als Hochburg des Islamischen Staates im Irak und in Syrien (ISIS) bekannt ist. Ich habe in einem ärmlichen Viertel der Stadt eine private Klinik betrieben und Vertriebene kostenlos medizinisch behandelt, die aus Homs oder Aleppo geflohen waren.
Stadt wurde täglich bombardiert
Im April und Mai 2013 nahmen die Kämpfe, Luftangriffe und wahllosen Schießereien zu. Die Freie Syrische Armee (FSA) hatte in Raqqa an Boden gewonnen, und die Stadt wurde täglich von Regierungstruppen bombardiert. Eines Tages stand ich mit einem Nachbarn außerhalb meiner Klinik, als er vor meinen Augen erschossen wurde. Da habe ich beschlossen, die Klinik zu schließen – es war einfach zu gefährlich. Eine Woche später traf eine Fassbombe eine Moschee in der Nähe und zerstörte gleichzeitig meine Klinik völlig. Zum Glück befand sich zu dem Zeitpunkt niemand im Gebäude.
Dann hörte ich, dass Ärzte ohne Grenzen für eine geplante Impf-Aktion in Tal Abyad, 100 Kilometer nördlich von Raqqa, Bewerbungsgespräche durchführte. Zwei Tage später bekam ich den Job.
Kontrolle über medizinische Einrichtungen
Inzwischen übernahmen nacheinander verschiedene Oppositionsgruppen die Kontrolle in Raqqa: Zuerst die FSA, dann Al Nusra und Ende 2013 kam die ISIS und versuchte, die Region zu übernehmen.
Anfangs kümmerte sich die ISIS nicht um medizinische Angelegenheiten. Aber das hielt nicht lange an: Nach ein paar Monaten beschlossen sie, die Krankenhäuser, Kliniken und medizinischen Vorräte in Raqqa zu kontrollieren. Die Menschen fühlten sich bedroht: Die meisten internationalen Organisationen verließen Raqqa, und viele syrische Ärzte flohen aus dem Land.
Ich beschloss, in meinem Haus eine Klinik zu eröffnen und dort medizinische Hilfe anzubieten. Als Arzt war mein Motto: ‚Kümmere Dich um die Menschen, aber versuche auch, dich selbst zu schützen‘.
Die Grenzen der medizinischen Ethik
Bald kamen ISIS-Mitglieder in mein Haus, um sich behandeln zu lassen. Ich fühlte mich nicht wohl damit, aber ich handelte gemäß der medizinischen Ethik: Behandle alle Patienten unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder politischen Überzeugung.
Aber das Auftauchen von ISIS-Mitgliedern vor meinem Haus löste Angst aus – bei meiner Familie und bei mir selbst. Sie kamen in Jeeps, machten viel Lärm und fuhren zu schnell. Nach ein paar Monaten, als die US-geführte Koalition mit den Bombenangriffen auf die ISIS begann, kamen sie eines Nachts und zwangen mich, mitzukommen, um ihre Verwundeten zu behandeln. Meine Familie war in großer Sorge, dass ich nicht zurückkommen könnte. Die ganze Zeit dachte ich, dass ich entweder durch die Luftangriffe oder durch die ISIS umkommen würde.
‚Ich gehe lieber auf eines der Todesschiffe, als hier zu bleiben.‘
Eines Tages tauchte die ISIS bei mir auf und übte Druck aus, dass ich im Krankenhaus arbeiten sollte, das sie in der Stadt kontrollierten. Die meisten Ärzte hatten Syrien verlassen, und sie brauchten mich. Doch ich weigerte mich. In Folge erhielt ich Drohungen. Ich konnte mich nirgends vor ihnen verstecken – weder in den kleinen Dörfern um Raqqa noch in der Stadt selbst. Ich erkannte langsam, dass mein einziger Ausweg war, Syrien zu verlassen. Ich dachte: ‚Ich gehe liebe auf eines der Todesschiffe als das Risiko einzugehen, hier zu bleiben‘.
Das Leben in Raqqa war schrecklich. Tagsüber hatten wir die Luftschläge der Regierung, in der Nacht die der Koalition. Der Lärm der Kampfjets war so laut wie ein Erdbeben. Ein enger Freund wurde in einem der Angriffe durch die Regierung getötet. Ich erkannte, dass mein normales Leben aufgehört hatte. Das einzige, was ich noch tun konnte, war, meine Familie zu retten. Ich machte mir Sorgen, dass meine Kinder in Syrien weder ein Leben noch eine Ausbildung haben könnten. Ich wollte mein Leben retten, um die Leben meiner Kinder zu retten.
Abreise ohne Familie
Ich begann damit, meine Abreise zu organisieren. Der Plan war, in die Türkei zu fliehen und von dort ein Schiff nach Europa zu nehmen, um weiter nach Holland zu reisen. Meine Frau befand sich im fünften Schwangerschaftsmonat mit unserem dritten Kind. Sie war durch die Schwangerschaft so erschöpft dass eine Reise sehr schwierig gewesen wäre. Also hatten wir die Idee, dass ich mit einem Freund voraus gehe, und meine Familie nachkommt, sobald ich die Immigrations-Dokumente habe.
Die letzte Nacht verbrachte ich mit meinen Kindern. Obwohl sie nicht wussten, dass ich gehen würde, spürten sie es irgendwie. Ich wünschte, ich hätte sie mitnehmen können.
Durch Checkpoints bis in die Türkei
Die Stadt Raqqa zu verlassen war nicht einfach, denn die Kämpfe zwischen der ISIS, kurdischen Gruppen, Al Nusra und der FSA gingen weiter. Ich musste drei Checkpoints zwischen Raqqa und Efreen passieren – es war, als würde ich drei verschiedene Länder durchqueren. Als ich die Türkei erreichte hörte ich, dass die Regierung Leute einsperrte, die nach Izmir wollten. Tief in meinem Inneren wünschte ich, dass diese Reise scheitern und ich nach Syrien zurückkehren müsste.
Als ich nach Izmir kam, war die Stadt völlig überfüllt: Menschen schliefen in den Straßen, alle hatten Hunger – denn sie hatten ihr Geld Schmugglern gegeben, doch die Abreise nicht geschafft. Wir hörten viele Geschichten von gesunkenen Schiffen. Mein Freund ich gingen an die Küste und blickten auf das Meer hinaus: Es war schwer, ins Wasser zu blicken und zu wissen, dass wir vielleicht bald darin ertrinken würden.
Mit dem Schiff über das Mittelmeer: ‚Manche weinten, andere beteten…‘
Als die Zeit gekommen war, mussten wir die schwere Entscheidung treffen, das überfüllte Schlauchboot zu besteigen. Manche Menschen weinten, andere beteten – jeder hat seinen eigenen Weg, mit der Angst umzugehen. Wir kamen auf der griechischen Insel Farmakonisi an und wurden am nächsten Tag nach Leros gebracht. Wir reisten von Griechenland nach Mazedonien, und dann weiter durch Serbien. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich seit sieben Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Ich träumte von einem Kissen, um mich darauf etwas ausruhen zu können, von Wasser, um mich waschen zu können und von einem Handy, um meine Familie anrufen zu können.
In Belgrad schaffte ich es endlich, eine SIM-Karte zu bekommen, um Zuhause anzurufen. Ich sprach mit meiner Frau und meiner Tochter, doch mein Sohn weigerte sich, mit mir zu reden. Er fühlte sich von mir verlassen – es brach mir das Herz.
Ankunft in Amsterdam mit ungewisser Zukunft
Von Belgrad aus wanderten wir über die Felder und zahlten dann einem Schmuggler 450 EUR, damit er uns nach Österreich brachte. Wir schliefen die folgende Nacht in einem Park in Wien, und kauften in der Früh Zugtickets nach Amsterdam.
Im Oktober brachte meine Frau unser Kind zur Welt, kurz nachdem ich in den Niederlanden angekommen war. Sie schickte mir ein Foto von unserem neugeborenen Sohn. Ich spreche jeden Tag mit meiner Familie, doch mein Sohn weigert sich immer noch. Immer wenn ich meine Tochter höre, beginnt mein Herz zu rasen wie ein Rennpferd, und ich kann mich nicht beruhigen. Es ist unglaublich schwer, die Kriegsflugzeuge im Hintergrund zu hören, zu wissen, dass sie jede Minute ihre Bomben abwerfen, zu wissen, dass meine Familie Todesängste aussteht, doch meilenweit weg zu sein, und sie nicht beschützen zu können.“
Die Namen wurden geändert.
Ein Gedicht von Dr. Marwan
Im Exil
in Zeiten geplatzter Träume
fällt Regen auf Land, das ihn nicht mehr braucht
und die Vögel hören auf zu fliegen.
So sieht es aus, wenn man nirgendwo hin gehört.
Ich bin bloß ein Flüchtling, mit einer Landkarte, gezeichnet aus verlorenen Schritten
und dem Gesicht eines Vaterlandes, gezeichnet aus Zigarettenrauch, befleckt mit Blut.