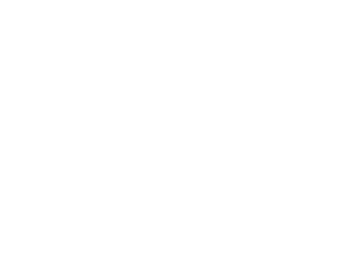Breadcrumb
Südsudan: “Nachts liege ich wach und denke an alle, die nicht überlebt haben.”
Themengebiete:

Mehr als 1,5 Millionen Menschen wurden im Südsudan vertrieben, seit der jüngste Staat der Welt auf Grund der politischen Krise im Dezember 2013 von einem gewaltsamen Konflikt überrollt wurde. Viele der vertriebenen Familien in entlegenen Gebieten haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und humanitärer Hilfe. Die Medizinerin Maartje Hoetjes flog im September mit dem Helikopter zu einem der entlegensten Gebiete im Südsudan, um vertriebene Familien aufzusuchen und ihren Gesundheitsstatus zu erheben. Sie schildert die dramatischen Schicksale der Menschen vor Ort, die tagtäglich um ihr Überleben kämpfen:
“Der Helikopter setzte mich in einem entlegenen Gebiet des Bundesstaats Upper Nile im Südsudan ab. Ich bin hier auf einer Erkundung um herauszufinden, was mit den hunderten Familien passiert ist, die aus ihren Häusern in Nasir geflohen waren, als die Stadt von schweren Bodenkämpfen erreicht wurde. Ich traf lokale Behörden und traditionelle Anführer, die mir sagten: ‚Die Menschen sind hungrig. Wir mussten laufen, daher haben wir nichts zum Anpflanzen. Es gibt nichts außer der Milch von unseren Kühen und essbare Pflanzen, die wir finden. Die Kinder sterben und die Frauen haben keine Hilfe, wenn sie gebären.‘
Die lokalen Gesundheitsfachkräfte zeichnen dasselbe Bild: Sie sehen mangelernährte Kinder und viele PatientInnen mit Durchfall und Lungenentzündung. Sie fühlen sich hilflos, versuchen in verfallenen Gesundheitsposten zu arbeiten, haben kaum Medikamente. In Mandeng ging ich durch einen leeren Markt im Zentrum des Dorfes und erklärte meinem Übersetzer, dass ich gerne direkt mit den betroffenen Familien sprechen würde. Wenig später wateten wir knietief durch einen Sumpf auf eine Gruppe von Schlammhütten zu, wo uns eine Frau schon zuwinkte.
Kaum Nahrung, Wasser aus dem Sumpf
Rose lebte mit ihrem Mann und ihren Kindern in Nasir, musste aber fliehen als die schweren Kämpfe in der Stadt losgingen. Sie ist der Familie dankbar, die ihre einen Platz in ihrer Hütte angeboten hatten. Sie ist dankbar für die Kühe und Ziegen, die sie mitnehmen konnte, damit sie Milch für die Kinder geben. Doch Rose erzählt, dass die Kühe krank sind: ‚Wir haben in den vergangenen Wochen sieben verloren. Doch es gibt Menschen, die fliehen mussten und kein Vieh mehr haben.‘
Sie zeigt auf einige Gräser im schlammigen Sumpf: ‚Siehst du das Grüne dort? Wir kochen es in Wasser.‘ Ich frage sie, woher sie das Wasser nimmt, da die Pumpen im Dorf nicht richtig funktionieren. ‚Das Wasser kommt aus dem Sumpf – die Kinder werden krank, sogar erwachsene Männer werden krank, aber das ist alles, was wir haben.‘
„Nachts denke an alle, die nicht überlebt haben…“
In Jigmir, einem kleinen Dorf am Sobat-Fluss, setze ich mich zusammen mit fünfzehn Frauen in den Schatten einer zerstörten Klinik. Viele dieser Frauen sind aus ihren Häusern geflüchtet, alle haben in den Kämpfen Familienmitglieder verloren, viele sind nun Witwen. Sie beginnen, über die Gewalt zu erzählen, die sie aus ihrem Zuhause vertrieben hat. Es sind Geschichten voller Hass, Tod, Ängsten vor der Zukunft. Eine Frau namens Frances berichtet mir von ihrer Situation: „Wir leben in einem schlammigen Sumpf. Jeden Tag müssen wir einen Platz suchen, wo wir nachts schlafen können. Und wenn wir endlich einen sicheren Ort für uns und die Kinder gefunden haben, kann ich nicht einschlafen. Ich liege nachts wach und denke an alle, die nicht überlebt haben…'
Neben der ständigen Sorge um ihre Sicherheit sind die Frauen einem täglichen Kampf ausgesetzt, um ausreichend sauberes Wasser und genug Nahrung für ihre Familien zu finden. Ihre Kinder sind oft hungrig. Die Worte einer jungen Mutter namens Lucy brachen mir das Herz: ‚Wenn ich an all diese Probleme denke, Probleme ohne Lösung, denke ich manchmal, dass es vielleicht besser wäre, die Dinge selbst zu beenden.‘
In der Gruppe ist es still. Die Frau neben Lucy legt einen Arm um sie. Eine andere Frau, Mary, beginnt von all dem Leid zu erzählen, dass sie durchstehen musste, aber auch über ihre Zuversicht und Hoffnung für die Zukunft: ‚Niemand kann in die Zukunft sehen, nur Gott weiß, was uns bevorsteht. Aber wir kämpfen uns durch jeden Tag, immer und immer wieder. Wir sind nie alleine.‘
Mobile Kliniken im Einsatz gegen Mangelernährung
Zwei Wochen später kehre ich zurück, um in diesem Gebiet ein neues Projekt zu starten. Wir bauen ein paar Gesundheitsposten auf und ein mobiles Team reist auf dem Sobat-Fluss von Dorf zu Dorf. Dort suchen wir mangelernährte Kinder, die in einem unserer therapeutischen Ernährungsprogramme aufgenommen werden müssen. Wir reparieren die kaputte Handpumpe.
Im Dorf Torkech bauen wir unsere mobile Klinik am trockensten Stück Land auf, das wir finden können. Hier treffen wir die „Outreach“-MitarbeiterInnen, die wir ausgebildet haben, um in den umliegenden Dörfern zu arbeiten. Sie haben bereits in den vergangenen Tagen vorab alle Kinder und schwangeren Frauen auf Zeichen von Mangelernährung hin untersucht und sie an uns überwiesen.
Ältere Menschen besonders gefährdet
Als wir gerade das erste Kind behandeln, sehe ich eine ältere blinde Frau gestützt von ihren Enkelkindern gehen. Ihr Rücken ist gekrümmt, ihre Haut faltig, ihre Arme und Beine dünn wie Stöcke, und zwei weiße Flecken in ihren Augen trüben ihre Sicht. Ich gehe zu ihr und grüße sie.
Ich deute ihren Enkeln, dass ich den Umfang ihres Oberarms messen möchte, weil sie schwer mangelernährt aussieht. Ich halte sanft ihre Hände und lege das MUAC-Band um ihren Oberarm – sofort ist mir klar, dass sie tatsächlich schwer mangelernährt ist. Ich biete ihr meinen Arm an, führe sie zu einem Stuhl und bitte meine KollegInnen, sie in unser Programm aufzunehmen.
Sobald die Menschen sehen, dass die alte Frau aufgenommen wurde, werden immer mehr ältere Menschen aus ihren Hütten zu uns gebracht. Viele von ihnen sind sehr dünn, manche auch mangelernährt. Mir wird bewusst, wie oft wir diese alten Menschen übersehen und uns nur auf die Kinder konzentrieren, obwohl diese Bevölkerungsgruppe so verletzlich ist.
Während ich ihre zarten Hände halte, frage ich mich, was diese alte Frau in ihrem langen Leben wohl alles gesehen und erlebt haben muss. Sie sucht meine Hände, versucht sie zu schütteln, und flüstert schwach: ‚Shukran‘ (Danke)."