Breadcrumb
Ebola in Town - Erste Eindrücke aus Westafrika
„Liberia?“, fragt der Taxifahrer ungläubig. Seine Reaktion fällt ähnlich aus, wie jene der meisten Menschen in den vergangenen Tagen. Offene Münder, rollende Augen, entsetztes Staunen, Verziehen der Wangenmuskulatur, begleitet von einem zischenden Laut. „Chhhhh, um Gottes Willen! Wieso machen Sie denn nicht irgendwo Urlaub? Ans Meer, ein bisschen erholen?“
Darauf habe ich keine Antwort, könnte aber auch mit der Uhrzeit zusammenhängen. Es ist fünf Uhr morgens und ich befinde mich auf dem Weg zum Flughafen Wien, um mit dem Pyjama-Jumbo, dem frühesten Flugzeug des Tages nach Genf zu fliegen. Von dort geht es weiter über Paris nach „Ebolaland“, wie es der Taxifahrer nennt.
Ich fühle mich beobachtet. Unentwegt starren Passagiere und Flugpersonal auf die rote Tasche in meinen Händen, die von einem Logo von Médecins Sans Frontières (MSF) geziert wird. „Ebola..., Guinea..., Westafrika...“, höre ich sie Wortfetzen flüstern. Die Kombination aus der Tasche und meiner Präsenz vor dem Abfluggate nach Freetown/Conakry lassen unschwer erkennen, warum ich hier bin und wohin es mich führt. Die Paranoia fängt bereits an und ich habe Europa noch nicht einmal verlassen. Interessiert lese ich ein Flugblatt auf dem Flughafen von Paris, das über Ebola und seine Übertragungswege informiert. Wildfremde Menschen kommen auf mich zu und bedanken sich für die Arbeit, die MSF in Westafrika leistet. Ich leite es gerne weiter!
Seit Monaten schon geistert das Gespenst „Ebola“ durch Westafrika und hinterlässt eine Spur des Grauens. Viel mehr als ein Gespenst gleicht Ebola eigentlich einer Geißel. Sie zerreißt Familien, trennt Kinder von ihren Eltern, Frauen von ihren Männern und Brüder von ihren Schwestern. Ebola rottet ganze Dörfer aus, macht aus lebendigem Landleben Geisterstädte. Ebola verschont niemanden und nimmt sowohl junge als auch alte Menschen mit ins Grab, Bauern ebenso wie Ärzte. Und Ebola ist verdammt hartnäckig und lässt sich seit dem jüngsten Ausbruch nur schwer eindämmen. MSF Mitarbeiter tun, was sie können, stoßen aber an ihre Grenzen. Niemand da draußen, der oder die gerne einen Nobelpreis gewinnen möchte?

Dass sich an Ebola ironischerweise auch verdienen lässt, beweisen derzeit viele Musiker in Westafrika, die einen Hit nach dem anderen produzieren. Auch wenn die Rhythmen und Texte unterschiedlich sind, ist der Inhalt dieser Lieder der gleiche. „Ebola in town“ von Shadow & D12 spielt derzeit alle liberianischen Radios rauf und runter. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Umgeben von grünen Hügeln liegt im nördlichen Hochland Liberias eine Kleinstadt mit dem Namen Foya. Hier kümmert sich das medizinische Personal von MSF in einem Case Management Centre (CMC), einer Art Behandlungsklinik, um Patienten, die von der Geißel Ebola befallen sind. Der Name „CMC“ wurde von Samaritan’s Purse eingeführt, einer Organisation, die zuvor in Foya tätig war und das im Westen wohl bekannteste Opfer der Ebola gestellt hat. Alle Welt kennt die Bilder von Dr. Kent Brantly, als er im Astronautenanzug einem Krankenwagen entsteigt, um sich in eine mehrtätige Isolation zu begeben. Jener Arzt, der sich im Kampf gegen Ebola selbst damit infizierte – und überlebte. Als Konsequenz verließ Samaritan’s Purse Liberia und MSF übernahm die Arbeit.

Vor knapp zwei Wochen bin ich gelandet in diesem Teil Afrikas, der seit Monaten die Schlagzeilen der Weltnachrichten füllt und neben diesem durchsichtigen Schleier Ebola, der Menschen still und leise attackiert und schließlich brutal tötet auch mit Folgekonsequenzen zu kämpfen hat. Viele Flugverbindungen nach Westafrika wurden gestrichen, Schiffe legen nicht mehr in den Häfen von Monrovia, Conakry und Freetown an. Import- und Exportverbote belasten aufgrund von Grenzschließungen nicht nur die Wirtschaftslage dieser Länder, sondern verursachen auch drastischen Nahrungsmangel. Ganze Dörfer und Stadtteile, wie das stark besiedelte Westpoint in Liberias Hauptstadt Monrovia, werden unter Quarantäne gestellt und mittels Waffengewalt überwacht. Über all diesen Aktionen steht ein weiteres Phänomen: Angst. Aber, ist diese Angst berechtigt oder eine Reaktion auf die Panikmache der Medien?

„Wir entschuldigen den langsamen Service an Bord heute“, sagt der Chef des Kabinenpersonals auf dem Flug nach Conakry. „Die Hälfte unseres Teams streikt und ist heute nicht zur Arbeit gekommen.“ Den Grund nennt er nicht, man kann es sich denken. Die Maschine ist beinahe voll. Angespannte Stimmung verbreitet sich im Flugzeug genauso wie die eiskalte Luft aus der Klimaanlage. Niemand versucht seinen Sitznachbarn zu berühren. Auf der Titelseite einer Zeitung ist zu lesen: „Mob befreit Patienten“ – und handelt von den jüngsten Ereignissen in Monrovia, als mehrere Ebola-Infizierte aus einer interimistischen Klinik gewaltsam entrissen wurden.
Nach einer kurzen Nacht in Conakry geht es am nächsten Morgen mit einem Kleinflugzeug des World Food Program (WFP) nach Kissidougou, mitten im guineischen Hochland. Die regulären Kleinflugzeuge haben ihren Betrieb aufgrund der Ebola eingestellt – und seit kurzem springt die UNO ein und fliegt in dem kriegsgebeutelten Länderdreieck Sierra Leone, Guinea und Liberia quer durch die Gegend. Vor dem Start verteilen die Piloten „aus Sicherheitsgründen“ Masken und Handschuhe an die Passagiere. Die Paranoia als ewiger Wegbegleiter. Eineinhalb Stunden später landet die Maschine auf der roterdigen Piste. Ein paar Feldarbeiter sind stehen geblieben, um das Spektakel zu beobachten. Einige Zeit später erscheint aus dem Nichts ein MSF Land Cruiser und bringt uns achtzig Kilometer in südöstlicher Richtung nach Gueckedougou, wo MSF ebenfalls ein Ebola CMC führt. Die Fahrt dauert drei Stunden, ist mühsam und holprig – und dennoch will man sich nicht beschweren, denn immerhin gab es einen Flug nach Kissidougou. Andernfalls hätte die Reise von Conakry nach Gueckedougou, nahe der Grenze zu Liberia, mit dem Auto knapp zwei Tage gedauert. Ein Mittagessen später befinde ich mich am Ufer des Makona Flusses wieder: Die guineisch-liberianische Grenze, ein Ort an den ich in meinen kühnsten Träumen nicht gedacht hätte, zu besichtigen. „MSF-Reisen“, sag ich nur. Es regnet in Strömen.

Auch wenn die Grenze offiziell geschlossen ist, lassen uns die Grenzbeamten passieren. Fragen stellen sie keine und stempeln schweigend den Reisepass. Mit einer Piroge überqueren wir den Fluss und – schwupps – schon sind wir in Liberia. Fünfzig Kisten mit Sicherheitsequipment für das medizinische Personal werden in die wartenden MSF Autos verladen und kurz darauf sind wir in Foya.

Martin Zinggl ist seit August als Communication Officer in Liberia im Einsatz.
Weitere Beiträge von Martin Zinggl lesen:
"Würde trotz Leid" - Foto-Reportage aus dem Flüchtlingslager Domiz im Irak
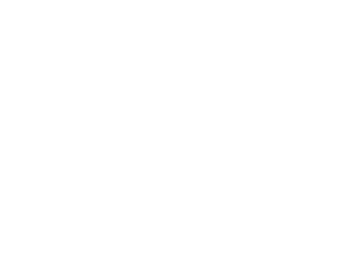


Liebe Frau Wick,
vielen Dank für Ihr Kommentar - Martin Zinggl ist kürzlich aus Liberia nach Österreich zurückgekehrt und erholt sich derzeit von seinem Einsatz. Bitte wenden Sie sich daher einfach mit Ihrer Anfrage direkt an unsere KollegInnen in Deutschland, die mit Ihnen eine etwaige Kooperation koordinieren können:
http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/ansprechpartner
Herzliche Grüße,
Hanna Spegel
Ärzte ohne Grenzen Österreich
Pagination
Neuen Kommentar schreiben