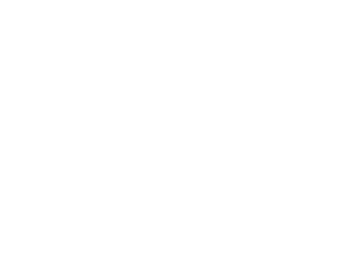Breadcrumb
Themengebiete:
Seydou, 19, aus der Elfenbeinküste

An manchen Tagen fühle ich mich schrecklich wegen meiner Entscheidung, aber am Ende weiß ich, dass sie richtig war - für meine Familie.
Aufbruch
Das Aufwachsen in der Elfenbeinküste war für meine Familie und mich ziemlich schwierig. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nie eine normale Kindheit haben würde. Ich lebte allein und meine Eltern waren nicht oft da, ich hatte keine Unterstützung und fühlte mich täglich für alles verantwortlich. Ich konnte kein Kind sein und mit anderen in meinem Alter zum Beispiel Fußball zu spielen.
Mit 12 verließ ich die Schule. Alles, was ich dann tat, war arbeiten. Mit 15 änderte sich meine Welt. Meine Freundin wurde schwanger und wir beschlossen, dass es an der Zeit war, selbstständig zu werden, auszuziehen und ein Leben als Familie zu beginnen. Also sparte ich ein Jahr lang alles, was ich einnahm, und machte mich mit 16 Jahren auf den Weg nach Europa.
Zuerst ging ich nach Mali und blieb dort einige Monate; tagsüber arbeitete ich auf dem Bau und nachts auf einem Markt. Dann ging es nach Algerien, wo ich knapp acht Monate lebte. Es war sehr schwierig, Arbeit zu finden, also nahm ich jeden Job an, den ich finden konnte.
Durch die Sahara
Dann durchquerte ich die Sahara. Das war eine schlimme Zeit. Auf der Ladefläche des Lastwagens der uns durch die Wüste fuhr, waren viele Männer zusammengepfercht. Ich hüpfte hinein, hielt mich an einem Stock fest und sah niemanden an. Ich blieb stundenlang in dieser Position. Wir hatten weder Wasser noch Essen. Als es dunkel wurde, hatte der Lastwagen eine Panne. Alle 45 Personen wurden aufgefordert, auszusteigen. Ich sprang heraus und setzte mich hinten auf den Lkw, in der Hoffnung, dass jemand und das Problem beheben würde.
Ich blieb eine Woche lang in der Wüste. Nach drei Tagen gingen uns die Lebensmittel und das Wasser aus. Ich verlor mit jedem Tag die Hoffnung. Schließlich kam ein Laster, um uns zu retten. Der Fahrer versorgte uns mit Wasser und Lebensmitteln und nahm uns durch den Rest der Sahara mit.
Libyen
Wir kamen in der Stadt Debdeb an, die an Libyen grenzt. Unser Fahrer kannte einen Schmuggler kontaktierte ihn, um uns nach Libyen zu bringen. Er warnte uns, dass das Leben in Libyen nicht einfach sein würde: Es herrsche Krieg und Misshandlung von dunkelhäutigen Menschen seien an der Tagesordnung. Mir war das egal.
Ich wusste, dass ich gehen musste. Ich war schon so weit gekommen. In Libyen fand ich verschiedene Jobs, aber die Bezahlung war miserabel. Manchmal bekam ich 10 Dinar, manchmal 20 Dinar. Am schlimmsten war es nach der Schicht, wenn einige der Männer versuchten, mein Geld zu stehlen oder einen dafür zu schlagen.
Bei einem meiner vielen Jobs lernte ich einen jüngeren Mann kennen, der mir erzählte, er habe einen Schmuggler gefunden, der ihn zum Meer bringen würde. Im April 2021 fuhr er aufs Meer hinaus. Ein paar Tage später erfuhr ich, dass er und 130 weitere Menschen gestorben waren, nachdem ihr Boot im Meer gesunken war. Ich geriet in Panik. Was sollte ich tun? Ich beschloss, mich ein wenig zurückzuziehen und weiter zu arbeiten, um meine Gedanken zu ordnen. Ich machte mir Sorgen, dass dies auch mir passieren könnte. Ich könnte auf See sterben. Ich hatte so viele Bedenken. Nach einigen Monaten dann fand ich einen Schmuggler und bezahlte 400 Euro.
Ich musste es durchziehen, meiner Frau und meinem Baby zu Hause zuliebe.
Wir verließen die Küste von Zawiya um 21 Uhr in Richtung Meer. Am nächsten Tag, gegen 11 Uhr, ging der Treibstoff zur Neige und unser Motor setzte aus. Ich dachte, das sei das Ende und ich würde sterben. Dann, um 18 Uhr, sahen wir ein schnelles Schiff mit libyscher Flagge auf uns zukommen. Ich wusste, dass es vorbei war. Ich würde nicht nach Europa kommen. Ich würde zurück nach Libyen gebracht werden.
Die Libyer brachten alle 96 von uns in ein Gefangenenlager in Tripolis, dann trennten einige der Wachen eine kleine Gruppe von uns. Von dort aus brachten ein paar Männer in hochmodernen Autos sechs von uns zu einem Haus. Dort gab es kein Licht. Ich hatte Angst. Ich dachte, wir seien vielleicht entführt worden und würden getötet werden.
Am nächsten Tag wurden wir zur Arbeit auf einer Baustelle eingeteilt. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, ohne Pause, kaum etwas zu essen. Am dritten Tag kam ich endlich frei. Das war ein tolles Gefühl. Unmittelbar nach der Befreiung dachte ich daran, die Grenze wieder zu überqueren. Ich hatte Angst, wieder von den Libyern abgefangen zu werden, aber das war der einzige Ausweg aus dieser Situation. Diesmal hatte ich keine Angst vor dem Wasser oder vor dem Tod.
Der Tod ist das Schicksal eines jeden Menschen.
Mittelmeer
Ein paar Wochen vergingen, und ich bezahlte meinen Weg zum Meer. Diesmal brachten mich die Schmuggler nach Sabratha, und ich wurde mit anderen Menschen in einem verlassenen Gebäude zurückgelassen. Dort blieben wir zwei Wochen lang. Es gab nichts zu essen oder zu trinken, und man sagte uns, wir sollten nicht weggehen: Wenn wir das täten, gäbe es Ärger und die Route wäre für uns zu Ende. Schließlich kamen die Männer und brachten uns am späten Abend hinunter zum Meer.
Nach fast 10 Stunden auf See wurden wir von diesem Schiff (das Such- und Rettungsschiff "Geo Barents" von Ärzte ohne Grenzen) gerettet. Ich könnte nicht glücklicher sein, hier an Bord zu sein. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir gerettet wurden. Manchmal wache ich um 3 oder 4 Uhr morgens auf und denke, dass ich träume, dass dies nicht real ist. Ich bin dankbar für alles, aber noch glücklicher werde ich sein, wenn ich in Europa an Land gehe. Ich kann es kaum erwarten, meine Frau und mein Kind anzurufen, wenn wir Europa erreicht haben. Es ist kein gutes Gefühl, von ihnen getrennt zu sein. An manchen Tagen fühle ich mich schrecklich wegen meiner Entscheidung, aber am Ende weiß ich, dass sie richtig war - für meine Familie.
Nayah, 32, aus Kamerun

Alles, was ich will, ist sie sprechen zu hören.
Aufbruch
Ende 2014 brachte ich Nia zur Welt. Sie wurde mit vielen Behinderungen geboren. Ich habe versucht, ihr zu helfen und ihr das Leben so einfach wie möglich zu machen. Es war das Schwerste, was ich je tun musste. Sie brauchte viel Aufmerksamkeit und Medikamente, damit sie sprechen konnte, was ich mir nicht leisten konnte. Ich war verloren und wusste nicht, wie ich meiner Tochter sonst helfen sollte. Es hat mich zerrissen.
Nachdem ich zwei Jahre lang in dieser Situation gelebt und Geld gespart hatte, war es an der Zeit. Ich musste ihr eine bessere Betreuung bieten als die, die ihr in Kamerun geboten wurde. Im Jahr 2016 beschloss ich schließlich, nach Europa zu gehen. Das wurde zu meiner Hauptmotivation: Nia beim Sprechen zu helfen und ihr ein besseres Leben zu ermöglichen.
Ich verließ Kamerun im Juni 2016. Zuerst durchquerte ich Nigeria, dann Niger und dann Algerien. Es war eine lange Reise. Ich brauchte etwa einen Monat, um diese drei Länder mit Nia zu durchqueren. Ich nahm jedes Verkehrsmittel, das ich mir leisten konnte: Auto, Bus oder Taxi. Ich wollte mich durch nichts aufhalten lassen. Als ich in Algerien einreiste, ging mir das Geld aus. Ich hatte Angst und war unsicher, wie es weitergehen sollte. Also suchte ich nach Arbeit und fand eine Stelle als Reinigungskraft. Im Jahr 2018 war ich bereit zu gehen.
Nordafrika
Ich schnappte mir Nia und das wenige Geld und Hab und Gut, das wir hatten, und machte mich auf den Weg nach Marokko, in der Hoffnung, über das Meer nach Spanien zu gelangen. Auf unserem Weg zur marokkanischen Grenze sah einer unserer Mitreisenden die Polizei. Ich hatte solche Angst.
Ich schnappte mir Nia und rannte los. Wir rannten und rannten und versuchten, es durch den Busch zu schaffen, aber wir wurden von der marokkanischen Polizei aufgehalten. Die Polizei schnappte uns alle. Es waren viele Männer und Frauen. Plötzlich kam es zu einer Schlägerei zwischen einigen der Männer und den Polizisten. Drei Männer wurden schwer verprügelt und dann vor den Augen von Nia und mir angeschossen und getötet.
Dann sahen die Polizisten mich an, packten mich und schlugen mich.
Sie schlugen immer wieder mit einer Peitsche auf mich ein, während ich um Hilfe schrie. Sie waren furchtbar. Sie nahmen alles mit: das wenige Geld, das ich noch hatte, und alle meine Papiere. Nachdem wir freigelassen worden waren, beschlossen wir, zurück nach Algerien zu reisen, wo ich eine Frau aus Kamerun kennenlernte, die Nia und mich bei sich in ihrer Wohnung wohnen ließ. Sie besaß ein kleines Restaurant und gab mir dort einen Job als Serviererin von Speisen und Getränken.
Die nächsten drei Jahre verbrachte ich damit, jeden Tag zu leben und zu arbeiten und zu versuchen, die Hoffnung am Leben zu erhalten. Jeden Tag dachte ich an dieses schreckliche Leben und an das Leben, das ich mir für Nia in Europa wünschte. Diesmal, so sagte ich mir, werden wir nicht durch Marokko reisen, sondern einen anderen Weg nehmen, nämlich den über Libyen. Ich kontaktierte eine in Deutschland lebende Freundin, die die Überfahrt vor ein paar Jahren gemacht hatte.
Libyen
Sie gab mir die Nummer eines Mannes, der mir bei der Überfahrt nach Libyen half. Die Schmuggler sind in Libyen allgegenwärtig. Als ich mit diesem Mann Algerien verließ, erfuhr ich, dass ich schwanger war. Ich verbrachte das nächste Jahr in Libyen und Monate später brachte ich schließlich meine zweite Tochter zur Welt. Nach der Entbindung half dieser Mann, uns in ein Haus mit vielen Frauen zu bringen. Uns wurde gesagt, wir sollten drinnen bleiben und das Haus nicht verlassen.
Eines Tages kam ein Schmuggler und holte uns alle, Frauen und Männer, aus dem Haus. Er setzte uns in ein Taxi, das uns in die Nähe des Ufers brachte. Ich konnte das Wasser sehen. Es war Nacht. Das Taxi hielt an und wir wurden alle in eine sehr kleine Hütte am Meer gedrängt. Ich hatte Angst. Es waren viele Menschen darin. Wir blieben hier zwei Wochen lang.
Mittelmeer
Als ich das Boot auf dem Meer betrat, war ich so verwirrt. Ich wusste nicht, ob ich sitzen oder stehen sollte. Ich habe zwei Kinder und nur zwei Arme. Es war wirklich eng. Viele Leute waren in Bewegung und schrien.
Ich hielt mein Neugeborenes in meinen Armen, während Nia zwischen meinen Beinen lag.
Nia schrie ständig, und da ich mein anderes Kind hielt, konnte ich Nia nicht so sehr beschützen, wie ich wollte. Ich habe versucht, Nia zu sagen, dass sie stark sein soll und dass alles gut werden wird. Ich will das Beste für Nia. Sie ist der Hauptgrund, warum ich Kamerun überhaupt verlassen habe. Sie ist der Grund, warum ich all diese Risiken eingegangen bin. Ich will, dass Nia eines Tages sprechen kann.
Alles, was ich will, ist, sie sprechen zu hören. Ich will nicht glauben, dass dies nie geschehen wird, und deshalb habe ich mein und ihres riskiert.
Aliou, 18, aus dem Senegal
Ich denke an meine Schwestern und Brüder, die in Libyen immer noch jeden Tag in Angst leben.
Aufbruch
Ich hatte große Angst zu gehen. Es gab sogar Leute, die ich kannte, die auf dem Weg nach Libyen und auf den Straßen von Libyen gestorben waren.
Zuerst verließ ich den Senegal und ging nach Algerien. Nach einem Jahr hatte ich endlich genug Geld gespart, um Algerien zu verlassen. Ich nahm Kontakt zu einem Schmuggler auf, der mich zu einem anderen Mann führte, der mir dann von einer Reise durch die Sahara erzählte. Ich hatte schreckliche Geschichten von Freunden gehört, die die Wüste durchquert hatten. Sie sprachen davon, dass sie Leichen vergraben hatten und tagelang ohne Essen und Wasser waren.
Sahara
Die Wüste ist viel, viel schlimmer als das Mittelmeer oder Libyen, denn sie ist ein Ort, wo alle Hoffnung vergeht.
Ich hatte Angst vor der Sonne und davor, dort zu sterben. Zu Beginn stieg ich in einen Lastwagen mit etwa 20 Personen. Wir waren alle aus demselben Grund dort: Um Libyen zu erreichen und das Meer zu überqueren. Viele von uns erzählten sich Geschichten und sprachen über ihre Hoffnungen. Die Fahrt dauerte viele, viele Stunden. Der Lastwagen hatte ein paar Mal eine Panne, und die Lebensmittel gingen uns schon nach wenigen Stunden auf der Straße aus.
Schließlich erreichten wir Libyen.
Libyen und Mittelmeer
Es war Nacht und wir wurden aufgefordert, aus dem Auto auszusteigen. Es dauerte einen Monat, bis ich eine Arbeit fand. Es war wieder auf dem Bau. Ich wusste, dass die Arbeit schwierig sein würde, aber was sollte ich sonst tun? Nachdem ich einige Wochen lang Geld gespart hatte, reichte es, um mir die Fahrt über das Meer zu bezahlen. An der Küste warteten viele Menschen, um in ein Boot zu steigen. Es war beängstigend, denn es war Nacht. Wir stachen in See, und ein paar Stunden später, im Morgengrauen, wurden wir von der libyschen Küstenwache aufgegriffen. Einige der libyschen Männer schlugen die Menschen im Boot.
Nachdem wir nach Libyen zurückgebracht worden waren, brachten die Männer uns alle ins Gefängnis. Es war hart. Ich wurde verprügelt. Alle wurden geschlagen. Man gab uns Fisch. Einen Fisch, den wir unter fünf Personen aufteilen mussten. Die Bedingungen waren schrecklich. Jeden Tag kam mir der Gedanke, dass ich sterben könnte. Ich wusste nicht, was ich sonst denken sollte. Die einzige Möglichkeit für uns, diesem Land zu entkommen, war die Flucht mit dem Boot. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Ich denke an meine Schwestern und Brüder, die in Libyen immer noch jeden Tag in Angst leben.
Um in Libyen oder auf dem Meer nicht zu sterben, braucht man viel Geduld und Hoffnung.